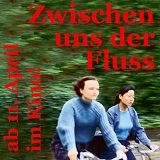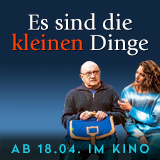Interview
„Im Grunde ist mir jede Ausrede recht, um in Schwarzweiß drehen zu können.“
Interview mit Sally Potter zu THE PARTY
Bereits mit 16 Jahren schmiss Sally Potter (*1949) die Schule, um eine Karriere als Filmemacherin zu verfolgen. Seither hat sie als Performancekünstlerin, Theaterregisseurin, Musikerin, Komponistin und Autorin gearbeitet und sieben Spielfilme gedreht. Potter experimentiert gern und probiert eigentlich bei jedem Projekt ein neues Genre und neue Stilmittel aus: In ORLANDO (1992), ihrem nach wie vor bekanntesten Film, unternahm sie die Verfilmung von Virginia Woolfs gleichnamigen Roman, der eigentlich als unverfilmbar galt, in THE TANGO LESSON (1997) spielte sie selbst die Rolle der Tangoschülerin Sally, in YES (2004) waren die Dialoge in jambischen Pentametern verfasst, und ihr Thriller RAGE (2009) war der erste Film, der auf Handy uraufgeführt wurde. Mit THE PARTY, der im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale lief, hat Sally Potter nun ihre erste Komödie gedreht – in Schwarzweiß, in knapp zwei Wochen und mit einem exzellenten Cast. Patrick Heidmann hat für INDIEKINO BERLIN mit Sally Potter über THE PARTY, Demokratie und Potters Rolle als Pionierin gesprochen.
INDIEKINO BERLIN: Ms Potter, THE PARTY ist Ihre erste echte Komödie. Was gab den Ausschlag dafür?
Sally Potter: Ich kann nicht einen konkreten Anlass ausmachen, der mich dazu gebracht hat, eine Komödie zu drehen. Aber ich verspürte in den vergangenen Jahren immer häufiger den Wunsch, die Menschen zum Lachen zu bringen. Dazu kam mein Interesse an den Gesundheitspolitik – und der angeschlagenen Gesundheit der Politik. Ich begann mit dem Schreiben des Drehbuchs ausgerechnet während des britischen Wahlkampfs 2015, als die Labour Party auf erschreckende Weise von ihrer Spur abkam. Die Linken schienen plötzlich zu ängstlich zu sein um die Wahrheit auszusprechen. Das alles diente mir als Inspiration für meine Geschichte, deren Kern aber natürlich der Mikrokosmos persönlicher Beziehungen darstellt.
Wollten Sie ein politisches Statement setzen?
Oh nein, im Gegenteil. Für mich war THE PARTY von Anfang an als ganz bescheidener Film geplant. Ich habe überhaupt keine bestimmte Wirkung beabsichtigt. Vom Lachen einmal abgesehen. Mir ging es nicht drum, möglichst viele wichtige Themen unter einen Hut zu bringen oder dem Publikum eine Botschaft mitzugeben. Nur einen Blick auf das Ringen mit der Wahrheit, mehr hatte ich nicht im Sinn. Einen kleinen, bescheidenen Film, wenn auch mit großen künstlerischen Ambitionen.
Zu diesen Ambitionen gehört auch, dass Sie den Film in Schwarzweiß gedreht haben. Warum eigentlich?
Im Grunde ist mir jede Ausrede recht, um in Schwarzweiß drehen zu können. Und ich habe auch den Eindruck, dass es in letzter Zeit wieder ein gesteigertes Interesse an Schwarzweiß als Stilmittel gibt. In diesem konkreten Fall hatte ich das Gefühl, dass die schwarzweißen Bilder und das Betonen von Licht und Schatten ein wenig von Fesseln des Realismus befreien würden. So tritt eine leicht veränderte Realität zu Tage – und verleiht der Geschichte eine andere Intensität.
Erforderte diese Bildgestaltung eine Umstellung in der Arbeit?
Nein, das nicht. Aber ich habe viele Tests gemacht, bevor ich die Bilder fand, die mir vorschwebten. Farbtests, Linsentests, Kameratests – es dauerte wirklich eine ganze Weile, bis ich mich da durchgefuchst hatte. Mit meinem wunderbaren Kameramann Aleksei Rodionov experimentierte ich zunächst mit der Beleuchtung, am Ende diskutierten wir über Licht und Schatten im menschlichen Emotionshaushalt. Denn irgendwie bezieht sich das Schwarzweiß natürlich auch auf die Schattenlandschaften in unseren Beziehungen.

Ich überlege seit Jahren bei jedem meiner Filme, ob ich nicht vielleicht eine Rolle für Bruno Ganz habe
Der gesamte Film spielt in einer einzigen Wohnung, Ihr Ensemble umfasst gerade einmal sieben Schauspieler. Wie kompliziert ist bei einem solchen Stoff die Suche nach der passenden Besetzung?
Kompliziert nicht, aber zeitaufwändig. Ich habe natürlich immer schon im Vorfeld ein paar Schauspieler im Kopf, die ich mir gut vorstellen könnte. Weitere Vorschläge kommen dann von meinen beiden Casterinnen in London und Los Angeles. Und dann verbringe ich erst einmal Wochen und Tage damit, mir so viele Filme wie möglich von allen Schauspielerinnen und Schauspielern anzusehen, die in Frage kommen. Einfach um zu erkennen, was alles in ihnen steckt und womöglich schlummert. Irgendwann verschicke ich dann das Drehbuch, man trifft sich, und ob die Chemie zwischen uns stimmt, ist natürlich auch nicht unerheblich.
Einige Ihrer Schauspieler kannten Sie doch aber auch sicher schon vor dem Film, oder?
Bereits gearbeitet hatte ich vor THE PARTY nur mit Timothy Spall. Bei den anderen war ich natürlich bestens vertraut mit ihrer Arbeit, etwa im Fall von Kristen Scott Thomas oder auch Bruno Ganz. Trotzdem bin ich zweimal nach Zürich geflogen, um ihn zu treffen. Es reicht schließlich nicht, dass jemand gut spielen kann. Wir müssen uns vertrauen können, und ich muss eine Begeisterung für mein Drehbuch spüren. Besonders wenn – wie im Fall von THE PARTY – alle für den Mindestlohn arbeiten, mich eingeschlossen.
Bruno Ganz ist sicherlich die überraschendste Wahl. Wie kamen Sie ausgerechnet auf ihn?
Ehrlich gesagt überlege ich schon seit Jahren bei jedem meiner Filme, ob ich nicht vielleicht eine Rolle für Bruno Ganz habe. Bislang stets vergeblich, aber dieses Mal dachte ich plötzlich: „Moment, das könnte passen.“ Seit ich ihn damals in „Der Himmel über Berlin“ gesehen habe, geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Diese Zärtlichkeit, diese Mitgefühl – unvergesslich. Nicht umsonst ist Gottfried, seine Figur in THE PARTY, der einzige, der wirklich dauerhaft nett und liebenswert ist.
Unerwartet witzig ist er aber auch!
Dass Bruno das kann, hat mich nicht erstaunt. Denn auch wenn man ihn privat trifft, hat er eine wunderbare, ganz feine Ironie. Er selbst hat übrigens Gottfried als den größten Dummkopf von allen bezeichnet. Kaum etwas von dem, was er im Film sagt, würde Bruno im wahren Leben unterschreiben.
Lassen Sie uns noch einmal zur Politik zurückkommen. Im Film wird heftig über den Zustand der Demokratie diskutiert. Sind Sie selbst in dieser Hinsicht ernüchtert?
Die Demokratie wie wir sie haben ist sicher nicht vollkommen verkehrt. Aber ausbaufähig ist das Prinzip noch. Ich persönlich bin ein Anhänger der Konsenspolitik, auch wenn der Prozess der Entscheidungsfindung dort stets langsamer ist. Das reine Mehrheitsprinzip erscheint mir einfach nicht fair zu sein, das ist die große Schwäche unserer Demokratie. Denken Sie nur an die Brexit-Abstimmung: 51% der Bevölkerung durften da eine Entscheidung treffen, die 49% vehement abgelehnt haben. Das erscheint mir als Mehrheit bei einer so einschneidenden Wahl nicht groß genug zu sein. So etwas kann ein ganzes Land spalten. Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Verglichen mit einer Diktatur oder einem totalitären Regime ist die Demokratie, wie wir sie pflegen, etwas Großartiges.
Die Frage ist ja ohnehin, wem man zutraut, solche wichtigen Entscheidungen zu treffen...
Stimmt, und auch da habe ich am Status quo durchaus Zweifel. Die Vertretung des Volkes durch das Parlament ist jedenfalls nicht unproblematisch. Dadurch, dass wir unsere politische Verantwortung an jemanden abtreten, werden wir gleichzeitig faul und unzufrieden. Ich bin ziemlich sicher, dass sich für viele Probleme bessere und kreativere Lösungen finden lassen würden, wenn wir alle gezwungen wären, mehr Verantwortung zu übernehmen.
So viel Vertrauen haben Sie in das politische Denken Ihrer Mitbürger?
Aber ja doch. Ich weiß natürlich nicht genau, was die beste Form wäre, eine solche Beteiligung aller in der Praxis umzusetzen. Aber zuzutrauen ist uns allen einiges. Manchmal spiele ich mit meinen Freunden ein Spiel. Jeder muss sagen, was er umsetzen wollen würde, wenn er oder sie Premierminister, Bildungsminister oder Gesundheitsminister wäre. Und jedes Mal bin ich erstaunt, was für erstaunliche Vorschläge dabei zutage treten. Egal wen man fragt, Frauen oder Männer, jung oder alt. Sobald man jemandem eine Plattform gibt und die Erlaubnis, wirklich Verantwortung zu übernehmen, lassen sich wirklich bemerkenswerte Lösungen für viele Probleme finden. Davon bin ich überzeugt.
Sind Ihnen also Einzelpersonen in Führungspositionen suspekt?
Früher habe ich Herrschaft beziehungsweise die Führung durch einen Einzelnen komplett abgelehnt. In den frühen Tagen der Frauenbewegung erschien mir der Gedanke des Kollektivs der sinnvollste, ganz gleich um welche Entscheidungen es ging. Irgendwann allerdings inszenierte ich dann meinen ersten eigenen Film – und siehe da, plötzlich hatte ich die alleinige Führungsposition inne. Ich hatte eine rein weibliche, frauenbewegte Crew, die geschlossen gegen mich aufbegehrte, weil ich meine künstlerische Vision umsetzen wollte. Das erschien mir dann irgendwie doch auch unfair. Von daher kann ich mich schon einigen auf das Prinzip von Herrschaft, solange das bedeutet, dass jemand die Verantwortung für alle anderen übernimmt und sich dabei einem Kontrollsystem unterwirft. Denn was auf jeden Fall verhindert werden muss ist ein Missbrauch von Macht. Führung funktioniert nur, wenn man sich exakt an das hält, was mit den Geführten vereinbart ist.

Man will anerkannt werden dafür, dass man Talent hat und hart gearbeitet hat, nicht dafür, welches Geschlecht oder auch welche Hautfarbe man hat.
Wo Sie gerade Ihre ersten Erfahrungen als Regisseurin erwähnt haben: Wie sehen Sie die Situationen von Frauen hinter der Kamera heutzutage, um mal ganz pauschal zu fragen?
Puh... Sie ist auf jeden Fall besser als damals in meinen Anfangstagen. Aber Veränderung ist in unserer Branche ein wirklich unglaublich langsamer Prozess.
Wie war die Situation denn in Ihren Anfangstagen?
Der auffälligste Unterschied zu heute war sicherlich, dass ich allein auf weiter Flur war. Mein erster Spielfilm THE GOLD DIGGERS war 1983 der erste in Großbritannien inszenierte Film einer Frau dieser Größe, der auch in eine gewisse Anzahl von Kinos kam. Natürlich war ich nicht die erste britische Regisseurin überhaupt. Aber die paar anderen drehten winzigste Independent- oder Experimentalfilme.
Sie waren eine Pionierin!
Ganz offensichtlich ja. Gezwungenermaßen, denn bewusst vorgenommen hatte ich mir das nie. Selbst etliche Jahre später war die Situation immer noch kaum besser. Ich hatte ORLANDO gedreht und Jane Campion DAS PIANO. Und es kam ständig vor, dass wir verwechselt wurden. Mir gratulierten die Leute zum PIANO, ihr zu ORLANDO. Das lag nicht daran, dass wir uns so verblüffend ähnlich sahen oder unsere Filme nicht zu unterscheiden gewesen wären. Sondern daran, dass es außer uns eigentlich keine anderen Regisseurinnen mit einer solchen Bekanntheit gab. Dadurch wurden wir automatisch in einen Topf geschmissen. Davon kann zum Glück heute keine Rede mehr sein. Inzwischen gibt es eine große Anzahl wunderbarer, erfolgreicher Frauen hinter der Kamera.
In Deutschland wird nach wie vor über eine Quotenregelung diskutiert um für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Was halten Sie von solchen Maßnahmen?
Für mich ist die Quote ganz klar eine Medaille mit zwei Seiten, und ich bin immer ein wenig unsicher, welche für mich die relevantere ist. Einerseits sind drastische Maßnahmen manchmal einfach nötig. Wenn die Veränderung auf dem langsamen Wege ins Stocken gerät, ist es mitunter schlicht sinnvoll, sie auf schnellem Wege herbeizuführen. Denn daran, dass sie nötig ist, besteht ja kein Zweifel. Um das zu erreichen braucht es nicht immer unbedingt eine Quote. Mitunter tun es auch gezielte wirtschaftliche Maßnahmen. Dass Wenders, Schlöndorff und Fassbinder damals dem deutschen Kino zu einer Wiedergeburt verhelfen konnten, lag nicht nur an ihrem Talent. Sondern daran, dass etwa das ZDF beschloss, Geld in junge Filmemacher zu stecken. Gezielt Möglichkeiten schaffen für die Menschen, die die Veränderung mit sich bringen, ob nun mit Geld oder einer Quotenregelung oder beidem. Das ist die eine Seite der Medaille.
Und die andere?
Die liegt natürlich leider ebenfalls auf der Hand. Wenn man als Regisseurin zu hören bekommt, man habe seine Chance nur bekommen, weil man eben eine Frau sei, dann ist das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Damit umgehen zu müssen, ist verdammt hart, denn natürlich möchte man ausschließlich für seine Arbeit beurteilt werden. Man will anerkannt werden dafür, dass man Talent hat und hart gearbeitet hat, nicht dafür, welches Geschlecht oder auch welche Hautfarbe man hat. Allerdings ist es natürlich so, dass man überhaupt erst einmal die Möglichkeit bekommen muss, sein Talent unter Beweis zu stellen. Wenn das von vornherein gar nicht möglich ist – und das ist für viele Frauen nach wie vor so – dann ist natürlich genau das der Punkt, an dem wir zur Problembeseitigung ansetzen müssen.
Das Gespräch führte Patrick Heidmann